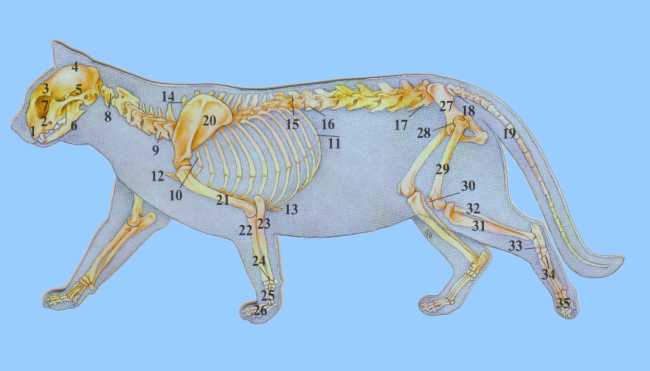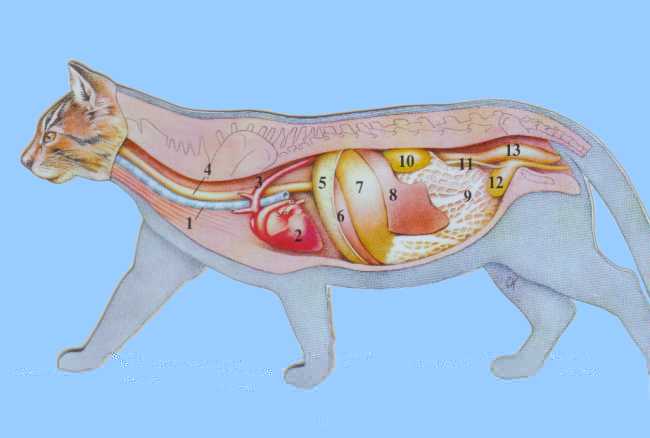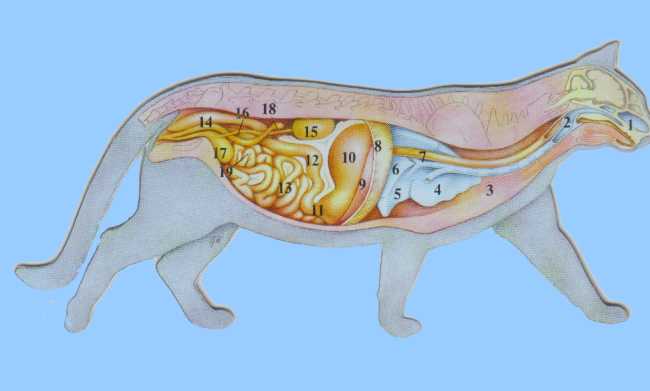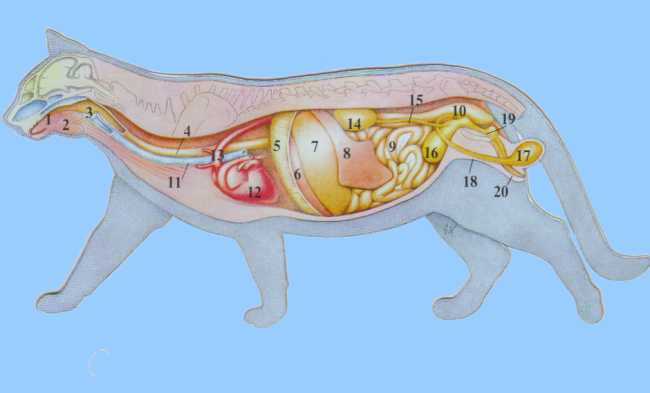| Auf
das Fell sind einige wesentliche
Lymphknoten in ihrer Lage aufgezeichnet |

|
| 1. |
Ohrspeicheldrüsenlymphknoten |
2. |
Kehlgangslymphknoten |
3. |
Oberflächliche
Halslymphknoten |
| 4. |
Achselhöhlenlymphknoten |
5. |
Oberflächliche
Leistenlymphknoten |
6. |
Kniekehllymphknoten |
|
| n |
| Aktiver
Bewegungsapparat - Skelettmuskulatur |
|
Die Bewegung der Gelenke erfolgt durch die
Einwirkung der Muskeln. Jeder Muskel besitzt einen Ursprungsbereich, der
oberhalb des Gelenkes liegt und einen Ansatz unterhalb des Gelenkes. Wird jetzt
der Muskel durch Einen Nervenreiz veranlasst, sich zusammenzuziehen, so verkürzt
er sich. Da zwischen Ursprung und Ansatz das Gelenk liegt, können die Knochen
bei der Verkürzung des Muskels bewegt werden. Als wesentliche Wirkungsgruppe
unterscheidet man zwischen den Muskeln nach ihrer Funktion: Beuger, Strecker und
Dreher. Die Wirkungsweise eines Muskels hängt immer von der Lage seines
Ursprungs und Ansatzes ab.
|
|
| |
| Darstellung
der oberflächlich gelegenen Muskulatur |
|
 |

|
| 1. |
Oberlippenheber & Erweiterer des Nasenloches |
2. |
Jochmuskel |
3. |
Rückzieher des äußeren Augenwinkels |
| 4. |
Heber des inneren Augenwinkels |
5. |
Äußerer Kaumuskel |
6. |
Lange Auswärtszieher des Ohres |
| 7. |
Brustbein-Kopf-Muskel |
8. |
Schulter-Hals-Muskel |
9. |
Schlüsselbeinstreifen |
| 10. |
Schlüsselbein-Oberarmmuskel |
11. |
Schulter-Hals-Muskel |
12. |
Trapezmuskel |
| 13. |
Deltamuskel |
14. |
Unterer Grätenmuskel |
15. |
Dreiköpfiger Muskel |
| 16. |
Breiter Rückenmuskel |
17. |
Unterer gezahnter Muskel |
18. |
Äußerer schiefer Bauchmuskel |
| 19. |
Innerer schiefer Bauchmuskel |
20. |
Oberarmmuskel |
21. |
Tiefer Brustmuskel |
| 22. |
Oberarm-Speichenmuskel |
23. |
Äußerer Speichenmuskel |
24. |
Gemeinsamer Zehenstrecker |
| 25. |
Äußerer Ellenbogenmuskel |
26. |
Tiefer Zehenbeugenmuskel |
27. |
Äußerer Zehenstrecker |
| 28. |
Runder Einwärtsdreher |
29. |
Innerer Speichenmuskel |
30. |
Oberflächlicher Zehenbeuger |
| 31. |
Schneidermuskel |
32. |
Spanner der Schenkelfaszie |
33. |
Mittlerer Kruppenmuskel |
| 34. |
Oberflächlicher Kruppenmuskel |
35. |
Schwanz-Oberschenkelmuskel |
36. |
Zweiköpfiger Oberschenkel-Muskel |
| 37. |
Halbsehniger Muskel |
38. |
Halbhäutiger Muskel |
39. |
Wadenmuskel |
| 40. |
Langer Wadenbeinmuskel |
41. |
Langer Zehenstrecker |
42. |
Vorderer Schienbeinmuskel |
| 43. |
Tiefer Zehenbeuger |
|
|
|
|
|
|
| n |
| Passiver
Bewegungsapparat - Knochen und Gelenke |
| Das tragfähige Skelettsystem gibt dem Katzenkörper
seine Stabilität und schütz gleichzeitig empfindliche Organe wie Herz und
Lunge im Brustkorb und das Gehirn im Kopf. Durch gelenkige Verbindungen der
einzelnen Knochen untereinander ist überhaupt erst eine Fortbewegung möglich.
Bei den Gelenken kann man einen Beugewinkel und einen Streckwinkel
unterscheiden. Wird das Gelenk gebeugt, so werden die freien Enden der Knochen
des Gelenkes einander genähert, wird es gestreckt, entfernen sich die
Knochenenden voneinander. Zur Ausführung der Vielzahl der Bewegungsabläufe
sind die einzelnen Gelenke sehr unterschiedlich gebaut und haben verschiedene
Bewegungsradien. |
|
| n |
| Darstellung
des Knochengerüstes/Skelett - weitere
Bilder des Katzenskeletts |
|
|
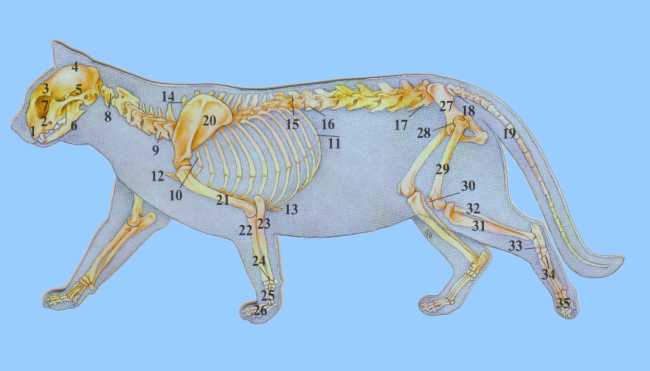
|
| 1. |
Zwischenkieferbein |
2. |
Oberkieferbein |
3. |
Stirn |
| 4. |
Hirnschädel |
5. |
Jochbogen |
6. |
Unterkiefer |
| 7. |
Augenhöhle |
8. |
Halswirbel |
9. |
6 von 7 ausgebildeten Halswirbeln |
| 10. |
2 Rippe |
11. |
13 Rippe |
12. |
Brustbeinanfang |
| 13. |
Brustbeinende |
14. |
1 Brustwirbel |
15. |
Letzter Brustwirbel |
| 16. |
1 Lendenwirbel |
17. |
7 Lendenwirbel |
18. |
Kreuzbein |
| 19. |
Schwanzwirbel |
20. |
Schulterblatt |
21. |
Oberarm |
| 22. |
Speiche |
23. |
Elle (22. & 23. = Unterarm) |
24. |
Vorderfußwurzel |
| 25. |
Vordermittelfuß |
26. |
Vorderzehen |
27. |
Becken |
| 28. |
Hüftgelenk |
29. |
Oberschenkel |
30. |
Kniescheibe |
| 31. |
Schienbein |
32. |
Wadenbein (31.&32. = Unterschenkel) |
33. |
Hinterfußwurzel |
| 34. |
Hintermittelfuß |
35. |
Hinterzehen |
|
|
|
|
| n |
| Verdauungsorgane |
| Im Bereich der Maulhöhle befinden sich die kräftig
ausgebildeten Zähne, von denen die Hakenzähne oder Fangzähne auffallen.
Besondere Bedeutung für die Nahrungsaufnahme haben im Oberkiefer der P4 und im
Unterkiefer der M1 als Reißzähne, mit denen die Katze die Nahrung abreißt.
Diese Nahrung wird in der Maulhöhle eingespeichelt (Speicheldrüsen) und dann
durch die Speiseröhre in den Magen transportiert, wo die Verdauung fortgesetzt
wird. Die Nahrung wird im Dünndarm mit den Abschnitten: Zwölffingerdarm(12),
Leerdarm und Hüftdarm weiter aufgespaltet, wobei Verdauungssäfte aus der
Leber(10) und der Bauchspeicheldrüse helfen. Im Dickdarm mit den Abschnitten:
Blinddarm, Grimmdarm und Enddarm(13) wird die Verdauung beendet und die nicht
verdauten Reste zum Kot eingedickt. |
|
| n |
| Kopfspeicheldrüsen
und Übersicht der Körperhöhlenorgane |

|
| 1. |
Ohrspeicheldrüse |
2. |
Unterkieferdrüse |
3. |
Unterzungendrüse |
| 4. |
Oberkieferbackendrüse |
5. |
Vorderer Lungenlappen |
6. |
Mittlerer Lungenlappen |
| 7. |
Hinterer Lungenlappen |
8. |
Herz |
9. |
Zwerchfell |
| 10. |
Rechte Leberhälfte |
11. |
Magen |
12. |
Zwölffingerdarm |
| 13. |
Enddarm |
14. |
Netz |
15. |
Niere |
| 16. |
Harnleiter |
17. |
Harnblase |
|
|
|
|
| n |
| Herz
und Kreislauf |
| Das Herz ist die Pumpe des Körpers, die für den
Bluttransport sorgt. Über die Venen gelangt das sauerstoffarme, verbrauchte
Blut zur rechten Herzhälfte und wird von hier zur Lunge gepumpt. Die Lunge
versorgt das Blut mit Sauerstoff, der für alle Vorgänge im Körper von
Bedeutung ist. Von der Lunge gelangt das Blut zurück ins Herz, in dessen linke
Hälfte und wird jetzt durch das Herz in die Hauptschlagader(3) gepumpt, von wo
aus es sich über die Arterien und Kapillaren im Körper verteilt und über die
Venen zur rechten Herzhälfte zurückfließt. |
|
| n |
| Übersicht
der Körperhöhlenorgane unter
besonderer Berücksichtigung der Lage
des Herzens |
|
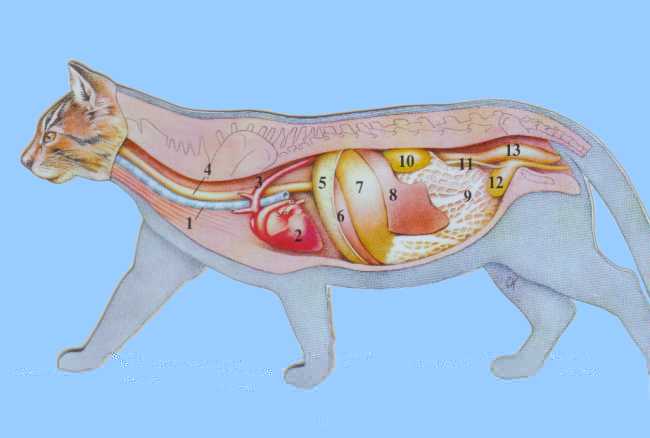
|
| 1. |
Luftröhre |
2. |
Herz |
3. |
Hauptschlagader |
| 4. |
Speiseröhre |
5. |
Zwergfell |
6. |
Leber |
| 7. |
Magen |
8. |
Milz |
9. |
Netz |
| 10. |
Niere |
11. |
Harnleiter |
12. |
Harnblase |
| 13. |
Enddarm |
|
|
|
|
|
|
| n |
| Luftwege |
| Die Atemluft gelangt durch die Nase in die Lunge.
In der Nase wird die Luft angewärmt und angefeuchtet. Diese Anfeuchtung ist für
die Sättigung der Luft in der Nase mit Wasserdampf und das Verdunsten der
Produkte der Drüsen in der Nase von Bedeutung. Hierdurch wird das Riechen
wesentlich unterstützt. Die so präparierte Luft gelangt durch den Kehlkopf und
Kreuzung des Verdauungsweges in die Luftröhre und von hier in die Bronchien.
Diese verzweigen sich vielfach in den Lungen bis zu feinsten Bläschen, durch
deren Wand hindurch der Austausch des mit der Luft eingeströmten Sauerstoffes
und des aus dem Blut stammenden Kohlendioxids erfolgt. Dieses Gas wird bei der
Ausatmung in die Umwelt abgegeben. Die Luft kann auch über die Maulhöhle
aufgenommen werden, was aber nur bei starker Belastung erfolgt. |
|
| n |
| Körperhöhlenorgane
unter besonderer Berücksichtigung der
Atemwege |
|
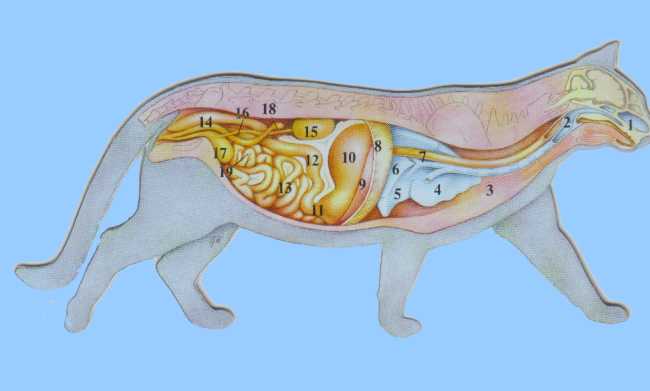
|
| 1. |
Nasenhöhle |
2. |
Atmungsrachen |
3. |
Luftröhre |
| 4. |
Vorderer Lungenlappen |
5. |
Mittlerer Lungenlappen |
6. |
Hinterer Lungenlappen |
| 7. |
Speiseröhre |
8. |
Zwergfell |
9. |
Leber |
| 10. |
Magen |
11. |
Magenausgang |
12. |
Zwölffingerdarm |
| 13. |
Dünndarm |
14. |
Enddarm |
15. |
Niere |
| 16. |
Harnleiter |
17. |
Harnblase |
18. |
Eierstock |
| 19. |
Gebärmutter |
|
|
|
|
|
|
| n |
| Männliche
Geschlechtsorgane |
| Man unterscheidet hier: die zwei Keimdrüsen-Hoden(17),
die die Samenzellen bilden-, die zwei Nebenhoden(17), die die Samenzellen
speichern, die zwei Samenleiter(18), durch die die Samenzellen transportiert
werden, und die Vorsteherdrüse(19), die zu dem Samen noch bestimmte Sekrete
dazugibt. Durch die Harnröhre, in die die Samenleiter münden, wird der Samen
beim Deckakt in die Gebärmutter abgegeben. Das Glied des Katers(20) ist nach
hinten gerichtet. |
|
| n |
| Körperhöhlenorgane
unter besonderer Berücksichtigung
der männlichen Geschlechtsorgane |
|
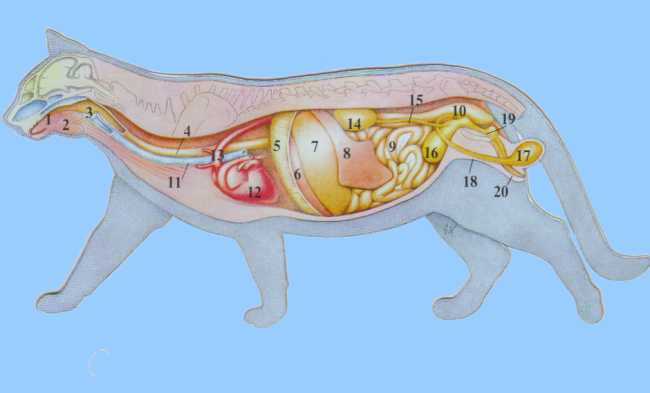
|
| 1. |
Maulhöhle |
2. |
Zunge |
3. |
Schlingrachen |
| 4. |
Speiseröhre |
5. |
Zwerchfell |
6. |
Leber |
| 7. |
Magen |
8. |
Milz |
9. |
Dünndarm |
| 10. |
Enddarm |
11. |
Luftröhre |
12. |
Herz |
| 13. |
Hauptschlagader |
14. |
Niere |
15. |
Harnleiter |
| 16. |
Harnblase |
17. |
Hoden und Nebenhoden |
18. |
Samenleiter |
| 19. |
Vorsteherdrüse |
20. |
Glied |
|
|
|
|
| n |
| Weibliche
Geschlechtsorgane |
| Diese gliedern sich von vorn nach hinten in zwei
Eierstöcke(14), zwei Eileiter, die Gebärmutter(15) mit ihren beiden Hörnern
und dem kurzen Körper, den Gebärmuttermund sowie die Scheide(17) und den
Scheidenvorhof. Beim Deckakt liegt das Glied in der Scheide und der Samen wird
in die Gebärmutter abgegeben. Am Eierstock sind zu dieser Zeit Eizellen frei
geworden, die in den Eileiter fallen. Hier treffen sie auf die aktiv vorwärts
wandernden Samenfäden und es kommt zur Befruchtung. Die befruchteten Eizellen
gelangen in die Gebärmutter, wo sie sich festsetzen und zu geburtsreifen Katzen
entwickeln. |
|
| n |
| Körperhöhlenorgane
unter besonderer Berücksichtigung der
weiblichen Geschlechtsorgane |
|

|
| 1. |
Herz |
2. |
Hintere Hohlvene |
3. |
Vordere
Hohlvene |
| 4. |
Unpaare Vene |
5. |
Hauptschlagader |
6. |
Zwerchfell |
| 7. |
Leber |
8. |
Magen eröffnet |
9. |
Zwölffingerdarm |
| 10. |
Dünndarm |
11. |
Niere |
12. |
Harnleiter |
| 13. |
Harnblase |
14. |
Eierstock |
15. |
Gebärmutter z.T. eröffnet |
| 16. |
Frucht in der Gebärmutter |
17. |
Scheide |
|
|
|
|
| n |
| Näheres
zu den oben aufgeführten Daten und
Abbildungen |
| Die Anatomie ist die Lehre von Lage, Gestalt und Bau
der Teile eines Lebewesens sowie ihrer räumlichen Anordnung. Am Beispiel der
Europäischen Kurzhaarkatze ( Hauskatze ) werden die wichtigsten anatomischen
Fakten aufgezeigt. Die oben aufgeführten Daten, die in Zusammenarbeit mit
Professor Dr. H. Wissdorf, Anatomisches Institut der Tierärztlichen Hochschule
Hannover und dem Grafiker G.Kapitzke, Isernhagen, entstanden sind, vermitteln
einen Einblick in den Bau des Katzenkörpers. Sehr detailliert zeigen sie das
Skelett, die Muskeln, die einzelnen Abschnitte der Verdauungsorgane, das Herz-
und Kreislaufsystem sowie die männlichen und weiblichen Geschlechtsorgane.
|
| Quelle: EFFEM-FORSCHUNG FÜR HEIMTIERNAHRUNG www.effem.de
Verfasser: Prof. Dr. H. Wissdorf Grafik: G. Kapitzke
|
|